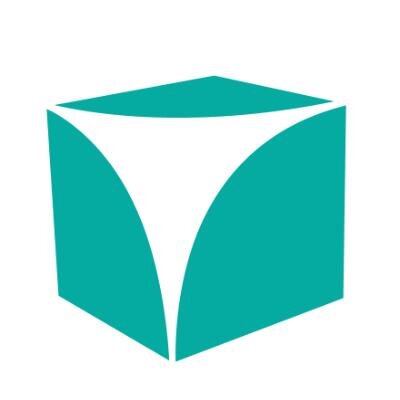20 au 23 janvier 2026 + 24 janvier jour additionnel Aménagement Intérieur.
SWISSBAU -
donner un nouvel élan ensemble
Messe Basel
Partenaire de la Swissbau 2026

La plus grande plateforme du secteur suisse de la construction
En tant que plateforme leader des secteurs suisses de la construction et de l’immobilier, le salon Swissbau réunit, en présentiel et en ligne, une grande communauté d’experts et de décideurs. Les entreprises nationales et internationales présentes fournissent une vue d’ensemble des innovations, des tendances et des solutions du secteur de la construction et de l’architecture. Le compte à rebours est lancé! Rendez-vous du 20 au 23 janvier 2026 à Messe Basel pour la prochaine édition de Swissbau. Le 24 janvier 2026, une journée supplémentaire sera entièrement consacrée à l’aménagement intérieur. Nous nous réjouissons de votre visite.
Premières et temps forts de Swissbau 2026
Découvrez les dernières tendances et innovations du secteur de la construction et de l’immobilier, en direct sur place à Swissbau 2026. Le programme varié promet des premières et des temps forts passionnants: de l’espace «Tendances aménagement intérieur» au Swissbau Lab, en passant par le point de rencontre de l’artisanat. Laissez-vous inspirer par des idées, des solutions et des produits novateurs pour l’avenir de la construction et de l’habitat.